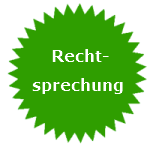 Auf der Seite von „Protokolle Assessorexamen“ gibt es neben den Prüferprotokollen für das 2. Juristische Examen auch viele Hinweise zu aktueller Rechtsprechung, die Gegenstand der Klausuren oder der mündlichen Prüfung werden könnten. Insbesondere werden examensrelevante Entscheidungen für Rechtsreferendare im „Fall des Monats“ detailliert aufbereitet. Wir stellen Euch hier den Fall des Monats aus dem November 2014 vor:
Auf der Seite von „Protokolle Assessorexamen“ gibt es neben den Prüferprotokollen für das 2. Juristische Examen auch viele Hinweise zu aktueller Rechtsprechung, die Gegenstand der Klausuren oder der mündlichen Prüfung werden könnten. Insbesondere werden examensrelevante Entscheidungen für Rechtsreferendare im „Fall des Monats“ detailliert aufbereitet. Wir stellen Euch hier den Fall des Monats aus dem November 2014 vor:
Zivilprozessrecht: Nachträgliche Erweiterung einer Klage um einen Hilfsantrag (Klagehäufung in Eventualstellung) – BGH, Urteil vom 04. 07. 2014
Der Sachverhalt (stark gekürzt):
Die Parteien bilden eine Wohnungseigentümergemeinschaft XX. Die Wohnung der Klägerin war im Jahr 2009 aufgrund eines festgestellten Feuchtigkeitsschadens mit einem Schimmelpilz befallen. Aufgrund dessen war die Wohnung für einen Zeitraum von 20 Monaten nicht bewohnbar. Hierfür und für weitere behauptete Schäden verlangte die Klägerin von den Beklagten Schadensersatz.
In der Wohnungseigentümerversammlung vom 21.07.2010 wurde unter TOP 7 folgender Beschluss gefasst:
„Der Versammlungsleiter stellt den Antrag, der Eigentümerin der Einheit 11 pauschal 3.000,00 € von den verlangten 5.710,50 € zu erstatten, und die Option einzuräumen, sofern die Gemeinschaft bei einer Schadensersatzklage gegen den Vorverwalter oder den Architekten rechtswirksam ihren Anspruch durchsetzen können, die restlichen Kosten inklusive der entgangenen Mieten einschließlich bis August 2010.
8 Ja-Stimmen (744/1.000stel)
2 Nein-Stimmen (164/1.000stel)
Der Antrag wird mehrheitlich angenommen.“
An der Beschlussfassung war auch die Klägerin beteiligt.
Die Klägerin behauptet, der ihr tatsächlich entstandene Schaden sei jedoch wesentlich höher. Insgesamt seien ihr Kosten in Höhe von 8.900,96 € entstanden. Erst nach anwaltlicher Beratung nach erfolgter Beschlussfassung sei ihr dann bewusst geworden, dass sie nun das Prozessrisiko trage und der Beschluss damit unbillig sei.
Die Klägerin beantragt, die Eigentümergemeinschaft XX zu verurteilen, an die Klägerin 8.900,96 € nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen.
Die Beklagten vertreten die Ansicht, es handele sich bei der Regelung in der Wohnungseigentümerversammlung vom 21.07.2010 um einen von der Klägerin selbst gewünschten zivilrechtlichen Vergleich. Vor der Beschlussfassung sei ausführlich beraten worden, wie die weitere Vorgehensweise zu erfolgen habe. Aufgrund des geschlossenen Vergleichs sei ein Rückgriff auf die ursprüngliche Rechtslage nicht mehr erlaubt. An die Stelle des ursprünglich eventuell gegebenen Entschädigungsanspruchs sei die neue Vereinbarung getreten.
Erst in der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin die Auffassung vertreten, der Zahlungsanspruch müsse zumindest in Höhe von 3.000,00 €, also bezüglich des Vergleichsbetrages begründet sein.
Die Entscheidung (etwas gekürzt):
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 3.000 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 5. November 2013 zu zahlen.
- Ursprünglicher Antrag unbegründet
Der ursprüngliche Antrag der Klägerin auf Zahlung von 8.900,96 € nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit ist zulässig, aber unbegründet. Der Zahlungsanspruch ist nicht begründet, da dieser Anspruch durch den wirksamen Vergleichsabschluss erledigt ist.
a) Vorliegen eines Vergleichs
Eine Auslegung gemäß §§ 133, 157 BGB ergibt, dass die Klägerin und die Wohnungseigentümergemeinschaft XX einen Vergleich geschlossen haben. Die Klägerin hat ein Angebot, gerichtet auf Abschluss eines außergerichtlichen Vergleichs, der Wohnungseigentümergemeinschaft XX unterbreitet. Die Klägerin sollte eine Zahlung in Höhe von 3.000,00 € erhalten. Damit sollten etwaige weitergehende Ansprüche gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft abgegolten werden. Der Klägerin sollte die Option erhalten bleiben, einen weiteren Betrag zu erhalten, wenn Ansprüche gegen den Architekten bzw. die ehemalige Verwaltung durchgesetzt werden können. Dieses Angebot wurde durch den Beschluss durch die Beklagte, an dem die Klägerin selbst beteiligt war, auch angenommen.
b) Nachteiligkeit unerheblich
Der Umstand, dass dieser Vergleich für die Klägerin nachteilig ist, da sie das Prozessrisiko im Verhältnis zu dem Architekten bzw. der ehemaligen Verwaltung übernimmt, ist unschädlich, da es den Grundsätzen der Privatautonomie entspricht, eine ungünstige Regelung treffen zu können.
c) Nichtzahlen für rechtliche Betrachtung unerheblich
Der Einwand der Klägerin, gegen einen Vergleichsabschluss spreche bereits der Umstand, dass die 3.000,00 € bislang nicht gezahlt worden seien, überzeugt nicht. Die Frage, ob jemand seinen Vertragsverpflichtungen nachkommt oder nicht, hat keinerlei Einfluss auf den vorgelagerten Akt des Vertragsabschlusses.
d) Bestimmtheit des Vergleichs
Der Beschlussinhalt zu TOP 7 ist auch hinreichend bestimmt. Aus dem Beschluss ergibt sich, dass die Parteien von einer Gesamtforderung der Klägerin in Höhe von 5.710,50 € ausgegangen sind. Hiervon sollte die Klägerin 3.000,00 € von der Wohnungseigentümergemeinschaft bekommen. Weitergehende Ansprüche gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft sollten durch die Regelung ausgeschlossen werden. Ein etwaiger weitergehender Anspruch sollte allerdings gegenüber dem Architekten bzw. dem Vorverwalter verfolgt werden.
e) Keine wirksame Anfechtung der Erklärung
Die Willenserklärung der Klägerin ist schließlich auch nicht wirksam gemäß § 119 Abs. 1 BGB angefochten worden, da Anfechtungsgründe nicht vorliegen. Ein Irrtum der Klägerin ist nicht ersichtlich.
Die Klägerin kann sich aufgrund des wirksam geschlossenen Vergleichs nicht mehr auf den ursprünglich eventuell gegebenen Schadensersatzanspruch berufen.
- Zahlungsanspruch in Höhe von 3.000 € gegeben
Der Klägerin steht aber ein Zahlungsanspruch in Höhe von 3.000 € aufgrund des geschlossenen Vergleichs gegen die Beklagte zu.
a) Unterschiedliche Streitgegenstände
Die auf dem Vergleich beruhende Zahlungspflicht und die ursprüngliche Schadensersatz- bzw. Entschädigungsforderung stellen unterschiedliche Streitgegenstände dar.
aa) Gegenstand des Rechtsstreits ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein prozessualer Anspruch; er wird bestimmt durch den Klageantrag, in dem sich die von dem Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund), aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet.
bb) Stützt sich der Kläger – wie hier – in erster Linie auf Schadensersatz- bzw. Entschädigungsansprüche und nur hilfsweise auf die Zahlungspflicht, die sich aus einem vor Klageerhebung geschlossenen außergerichtlichen Vergleich ergibt, ist der Zahlungsantrag identisch; er wird jedoch regelmäßig auf zwei unterschiedliche Lebenssachverhalte gestützt. Die Verpflichtungen aus dem Schuldverhältnis und die in einem außergerichtlichen Vergleich über das Schuldverhältnis vereinbarten Verpflichtungen sind in der Regel als verschiedene prozessuale Lebenssachverhalte anzusehen, und zwar auch dann, wenn der Vergleich keine Novation herbeiführen soll.
So liegt es hier. Dem Hauptantrag zufolge beruht die Zahlungspflicht auf verschiedenen Positionen, die auf Schadensersatz- bzw. Entschädigungsrecht gestützt werden; nach dem Hilfsantrag beruht sie dagegen auf dem Vergleich, in dem eine pauschale Zahlung vereinbart worden ist.
b) Zulässige Erweiterung der Klage durch die Klägerin
Entgegen der Ansicht der Beklagten hat die Klägerin ihre Klage in zulässiger Weise um einen Hilfsantrag erweitert.
Die Klägerin hat eine nachträgliche Klagehäufung in Eventualstellung vorgenommen, indem sie sich in der mündlichen Verhandlung hilfsweise auf die in dem Vergleich vereinbarte Zahlungspflicht berufen hat; denn sie hat damit erklärt, für den Fall einer Abweisung des Hauptantrags eine Titulierung der im Vergleichswege vereinbarten Zahlungspflicht herbeiführen zu wollen.
Entgegen der Auffassung der Beklagten dürfen Haupt- und Hilfsantrag einander widersprechen oder sich gegenseitig ausschließen. Eine nachträgliche Klagehäufung ist prozessual wie eine Klageänderung zu behandeln. Ihre Zulässigkeit ist an § 263 bzw. § 533 ZPO und nicht an § 264 Nr. 1 ZPO zu messen, wenn ursprüngliches Zahlungsbegehren und vergleichsweise vereinbarte Zahlung – wie hier – unterschiedliche Streitgegenstände darstellen.
Die Klagehäufung ist auch sachdienlich im Sinne von § 533 Nr. 1 ZPO. Es ist ein Gebot der Prozessökonomie, dass die Klägerin die Zahlungspflicht aus dem Vergleich in dem bereits anhängigen Verfahren titulieren lassen kann, nachdem der Abschluss des Vergleichs auch für die Entscheidung über die ursprüngliche Zahlungspflicht von entscheidender Bedeutung ist und die erforderlichen Beweise erhoben worden sind. Aus dem gleichen Grund sind auch die Voraussetzungen von § 533 Nr. 2 ZPO erfüllt.
Aufgrund der unter Punkt 1.) der Entscheidung festgestellten Wirksamkeit des Vergleiches der Parteien steht der Klägerin ein Zahlungsanspruch in Höhe von 3.000 € zu.









 Juristenkoffer.de ist einer der ersten und mit weit mehr als 35.000 zufriedenen Kunden einer der größten
Juristenkoffer.de ist einer der ersten und mit weit mehr als 35.000 zufriedenen Kunden einer der größten